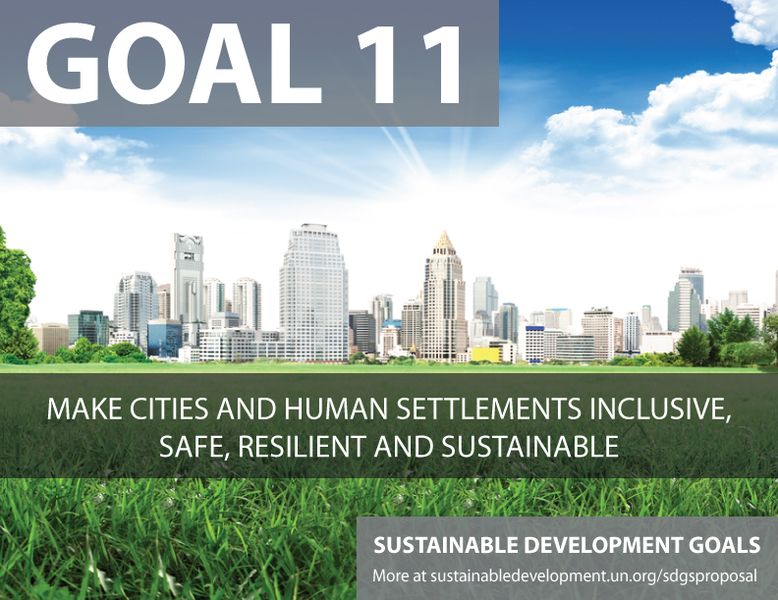
.
Eine Studie des Schweizer „Gottlieb Duttweiler Instituts“ im „Trendradar 1.09“ vom 22. Juli 2009 propagierte Resilienz als Zukunftsthema. Noch unter dem Eindruck der gerade begonnenen Finanzkrise fragte dieses Zukunftsinstitut: „Was brauchen wir, um Zukunft zu meistern? ‚Resilienz‘! Der Begriff beschreibt Schlüsselanforderungen an Menschen und Systeme: Unverwüstlichkeit und die Fähigkeit, Probleme bewältigen zu können“ (hier; vgl. KEGLER 2014, Seite 15).
Damit ist der Kern angedeutet, um den es bei diesem Begriff geht: Strategien für die Sicherung einer guten Überlebensfähigkeit. Dahinter verbirgt sich eine neue Qualität an Vision für die Gesellschaft. Das Institut zählt plakativ eine Reihe von gesellschaftlichen Themen auf, die zum Resilienzkanon gehören:
„Städte: von der Katastrophe zur Katharsis,
Handel: vom Outdoor- zum Survival-Store,
Konsum: vom Rausch zum Tausch,
Essen: vom ‚Refill‘ zum ‚Ich will‘,
Lernen: vom inneren Schweinehund zum nörgelnden Commitment-Device,
Innovation: vom Funkeln zum Funktionieren,
Unternehmen: vom Prassen zum Maßhalten,
Systeme: vom Spezialisten- zum Generalistentum.“
In der Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ (vgl. hier) wurde unter anderen am 24.10.2011 Dennis Meadows eingeladen, einer der maßgeblichen Autoren der Studie, „Grenzen des Wachstums“ 1972. Er meinte:
Jetzt befinden wir uns in einer revolutionären Zeitspanne. Es ist ungeheuer spannend, sich umzuschauen und zu versuchen zu verstehen, was hier wirklich passiert und was in der Zukunft passieren wird.
Letzten Samstag gab es [hier in Berlin] eine Occupy-Berlin Demonstration, die wissen auch nicht unbedingt, was sie wirklich wollen, aber sie wissen, dass die gegenwärtige Situation ihnen nicht gefällt. Und dieses Gefühl wird von Millionen, von Hunderten Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geteilt.
Wohin führt das? Ich weiß es nicht… Ich habe schon sehr oft gesagt, dass wir in den nächsten 20 Jahren, also bis 2030, mehr Wandel in diesem Land erleben werden, in dieser Union, in Europa, als man sich vorstellen kann. Politischer Wandel, sozialer Wandel, Umweltwandel, auch wirtschaftlich großer Wandel. Wir leben da schon in einer Zeit, in der viele der Annahmen, die wir alle haben und die wir halten, verändert werden. Und das ganze wird in unserer Lebenszeit passieren.Dennis Meadows Deutscher Bundestag am 24.10.2011.
Und während Dennis Meadows das sprach, stand folgendes Zitat von ihm an der Wand: „Now it is too late for sustainable development; our goal should be to increase resilience.“ (Jetzt ist es zu spät für nachhaltige Entwicklung; Unser Ziel sollte das stärken der Resilienz sein.) weiterlesen hier:
.
Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation (hier)
Es geht um die Darstellung der Transformationsnotwendigkeit und der Transformationsmöglichkeiten. Der Begriff Resilienz ist für die Darstellung sehr wichtig. Darunter ist die Widerstandskraft eines Systems gegen äußere Einflüsse gemeint. Diese Widerstandskraft hat zur Folge, dass ein System seine grundlegende Organisationsweise erhalten kann, obgleich es von äußeren Veränderungen in Bewegung versetzt wird und unter Druck gerät. Und wenn ein System unter Druck gerät, wie es derzeit in unserem Wirtschaftssystem der Fall ist, dann entstehen Lücken, die genutzt werden können. Solche Lücken sind zum Beispiel auch Momente, in denen der Halt verloren geht und sie eignen sich auch für üble Geschäftemacherei. In der Not verkauft sich fast alles. Aber solche Lücken sind auch welche, die mit solidarischen und nachhaltigen und zukunftsweisenden Ideen gefüllt werden können. Das Wanken als Chance zu begreifen, ist eine wichtige Grundhaltung, die es uns leichter machen wird in den kommenden Jahren (vgl. ANDREAE 2016, Seite 25-27).
„We know now, that we can measure the sustainability of any complex flow network […] an economy is a complex flow network in witch money flows […] had been able to measure the sustainability of any complex flow network on the basis of the fact that there are two things, that need to be two emerging properties need to be in balance: need to have efficiency and need to have resiliency […] in balance“.
Bernard Lietaer, 2013, ab Filmzeit 49:28, hier.
Resilienz bezeichnet auf den ersten Blick einen reaktive Vorgang und etwas Strukturkonservatives – das „Zurückschnellen“ eines Systems, einer technischen Struktur, eines Organismus oder einer Stadt in den ursprünglichen Zustand, nachdem eine Zustandsstörung stattgefunden hat, und ohne dass dabei die Basiselemente existentiell verändert werden. Kann es gelingen, ein System wiederherzustellen, nachdem es gestört worden ist, ohne dass dabei seine Grundfunktionen und Strukturen aufgegeben werden? Diese Frage mündet in die Grunddefinition:
Resilienz ist „die Fähigkeit von Gesellschaften/von Ökosystemen, auf Störungen bzw. Schocks zu reagieren und entscheidende Systemfunktionen aufrechtzuerhalten“.
(vgl. KEGLER 2014, Seite 18-19).
Für die räumliche Planung fand eine von der wissenschaftlichen Psychologie und den Umweltsystemwissenschaften eigenständige Aneignung des Begriffs ‚Resilienz‘ statt. Dafür steht die Initiative des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (Boston), USA, aus den Jahren 2001 und 2002. In einer Folge von Koloquien, die dem Thema „The Resilient City: Trauma, Recovery and Remembrance“ gewidmet waren, wurde das Thema umfassend ausgelotet. Aus dieser Reihe von Veranstaltungen ging ein Buch hervor, das als Meilenstein in der Resilienzdiskussion zum Themenfeld ‚Stadt‘ gelten kann: „The Resilient City – How Modern Cities Recover from Disaster“. Lawrence Vale und Thomas Campanella fungierten als Herausgeber (vgl. KEGLER 2014, Seite 21+64).
Es können zwei wissenschaftliche Gemeinschaften unterschieden werden, die beginnend in den 1950er Jahren, Forschung und Kommunikation zur Resilienz betreiben: die naturwissenschaftlich geprägte Forschergemeinschaft (von Psychologen bis Ökologen) sowie ein Segment von Stadtforschern, Geographen und Planern, die sich von der Katastrophenforschung angeregt, der Stadtentwicklung von der Warte einer Reaktion auf Desasterereignisse zuwandten. In jüngster Zeit deuten sich Verflechtungen an.
Aus der Sicht der Planungsforschung, die einen grundsätzlichen Ansatz zur Resilienz urbaner Systeme vertritt und dabei die Ergebnisse aus den Bereichen der Psychologie und Ökologie aufgreift, wird folgende Definition vorgeschlagen:
Resilienz bedeutet, Maßnahmen zu ergreifen, welche die Krisenfestigkeit von Metropolregionen, Städten, Gemeinden, ländlichen Räumen oder Wirtschaftsgebieten vorbeugend erhöhen, vorausschauende Maßnahmen, die städtebauliche, infrastrukturelle oder landschaftlich-ökologische Robustheit beinhalten und somit die Verletzlichkeit unserer Städte minimieren beziehungsweise zu ihrer strukturellen Stärke beitragen.
(vgl. KEGLER 2014, Seite 22)
Diese Definition bündelt die unmittelbare Daseinsvorsorge mit langfristiger Robustheit gegenüber Fehlentwicklungen, die längerfristig wirksam werden, aber heute unbedingt eingeleitet werden müssen. Die erwartbare Zukunft wird anders ausfallen, als es heute annehmbar ist, und gerade deswegen sollen heute Maßnahmen ergriffen werden, um nicht blindlings in Ungewissheiten zu steuern.
Der im letzten Jahrzehnt beobachtete Diffusionsprozess des Resilienzthemas in die breitere Fachdebatte hat seine wesentlichen Quellen an den Universitäten der Westküste in der USA, also traditionellen Forschungszentren, aber auch an außeruniversitären Think-Tanks wie dem „Postcarbon-Institute“ in Santa Rosa (hier) oder dem Vorreiter interdisziplinärer Forschung, dem „Santa Fe Institute“ in Arizona (hier). Die „Rockefeller Foundation“ widmet sich ebenfalls diesem Thema mit einem umfassenden Blog sowie Hintergrundinformationen, um eine internationale Diskussion anzustoßen und Erfahrungen zu vermitteln (hier). Darüber hinaus existiert mit der „Resilience Alliance“ (hier) ein vom Vordenker Brian Walker gegründetes Netzwerk, das wiederum zahlreiche Publikationen und Veranstaltungen sowie Forschungen betreibt und befördert. Der andere Pol des Resilienzdenkens liegt in Australien. ‚Down Under‘ ist inzwischen ein wichtiger Platz für die Kommunikation über urbane Klimaanpassung sowie zur resilienten Stadt geworden, wie beispielsweise das Kongressprogramm „Urban Design“ in Sidney seit 2009 zeigt. Die „Curtin University“ in Western Australia bildet einen Anker der Debatten, repräsentiert durch Peter Newman. Er hat im Jahr 2009, zusammen mit Timothy Beatley (USA) und Heather Boyer (USA) ein wegweisendes Buch zur Stadtresilienz herausgegeben, das operationalisierbare Aussagen zu Zielen und Inhalten von Resilient Cities beinhaltet, dessen Untertitel Responding to Peak Oil and Climate Change zugleich die Denkrichtung artikuliert (hier). Die Autoren orientieren sich empirisch stark an normativen Nachhaltigkeitskriterien, wenn sie Aussagen für die Zukunft einer resilienten Stadt entwickeln. Dennoch ist ihr Buch unter methodischen Gesichtspunkten ein Schlüsselwerk (vgl. KEGLER 2014, Seite 64-66).
Anders als Peter Newman hat der Engländer Rob Hopkins zur gleichen Zeit nicht nur ein Buch herausgegeben, das die Stadt „from oil dependency to local resilience“ darstellt, sondern damit ein Handbuch für eine praktisch agierende Bewegung zur Transformation der ölbasierten zur nachhaltig-resilienten Stadtentwicklung vorgelegt. Die von diesem Buch inspiririerte „Transition Town“-Bewegung formierte sich zunächst auf der britischen Insel im Städtchen Totnes als eine kommunal unterstützte Bürgerinitiative und breitet sich inzwischen weltweit aus. In dieser Anleitung finden sich zahlreiche Aspekte früherer ökologischer Bewegungen wieder, wie einleitend Richard Heinberg würdigend konstatiert. Das Resilienzthema gewinnt darin eine operationale Dimension. So hat die „Transition Town“-Bewegung praktische Modi entwickelt für konkrete Umbauschritte in Richtung einer Soll-Transformation.
Mit diesen Publikationen entstanden am Ende der Initial-Dekade des urbanen Resilienzdenkens (2000-2010) zwei unterschiedliche Veröffentlichungen, die sich unmittelbar an die Stadt-Gesellschaft als Gegenstand beziehungsweise Subjekt richten. Brian Walker schreibt in seinem mit Resilienz Practice überschriebenen Buch, dass das Thema resiliente Urbanisierung zwar höchst wichtig sei, aber noch keine ausreichenden Untersuchungen vorlägen, diese jedoch dringend notwendig seien. Folglich gibt es international Anzeichen sich verdichtender Forschungs- und Anwendungsprozesse zur Resilienz von Städten.
Das Resilienz-Zentrum in Stockholm (hier) hat sich inzwischen weltweit zu einem der führenden Think-Tanks auf dem Gebiet der Erforschung resilienter Systeme entwickelt. Es bietet Qualifizierungskurse an, führt Tagungen durch, publiziert und ist in strategische Projekte eingebunden. Das Zentrum wirkt als komplementäres Pendant und ist zugleich institutionell verbunden mit der „Resilience Alliance“ (hier), die auch als eines der Trägernetzwerk im Forschungsaustausch fungiert.
.
Stadtplanung für urbane Resilienz (Social Development Goal 11, Freiburg 2.2.2016, hier)
Die Abwägung von Optionen bei stadtplanerischen Entscheidungen fällt oft genug zugunsten von ‚Bewährtem‘ aus. Sich als Gemeinwesen solcher Lernhindernisse bewusst zu werden, öffnet den Weg für eine selbsterneuernde Stadt- und Regionalentwicklungspolitik sowie für eine entsprechende Planung. Das denken in Resilienzdimensionen bietet dafür Möglichkeiten, einen Raum für die Debatte zu finden, um diese planerisch konstruktiv im Sinne einer strategischen Transformation zu gestalten.
Einen Baustein auf diesem Wege der reflektierenden Erkundung womöglich resilienter Charakteristika von Regionen legte das „Pestel-Institut“ in Hannover im Jahr 2010 mit einem Atlas zur Regionalen Krisenfestigkeit vor – eine auf Indikatoren gestützte Bestandsaufnahme auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte“. Die Untersuchung folgt den Intensionen des „Club of Rome“, dessen Mitglied der Institutsgründer war, und ging von der Annahme aus, dass eine nächste Krise kommen werde und, dass die Widerstandsfähigkeit gegen Krisen unterschiedlicher Herkunft folglich ein Merkmal für die Zukunftsfähigkeit von Regionen und Städten sei. „Diese Bestandsaufnahme ist ein erster Ansatz einer über die Ökonomie hinausgehenden Zusammenstellung von Kriterien für ‚Krisenfestigkeit‘ oder Resilienz von Regionen. Jeder einzelne Indikator und seine Bewertung sind diskussionswürdig. Und genau diese Diskussion möchten wir in den nächsten Monaten führen, um dann mit den neuen Erkenntnissen eine neue Bewertung der Regionen vorzunehmen (vgl. KEGLER 2014, Seite 58).
Das Fazit der Studie:
„Insgesamt zeigt die Studie, dass nicht unbedingt internationale Wettbewerbsfähigkeit Sicherheit für die Zukunft signalisiert. Gerade in der öffentlichen Diskussion eher vernachlässigte Bereiche bieten Schutz vor den Auswirkungen von Krisen. Dezentrale Energieerzeugung, soziale Stabilität, Verfügbarkeit von land- und forstwirtschaftlichen Flächen und Arbeitsplätze vor Ort helfen bei der regionalen Abfederung weit mehr“
Die Indikatoren, deren grundsätzliche Frage nach der Auswahl von Bewertungskriterien für Resilienz und dem numerischen Ranking und deren Deutung mögen wohl angezweifelt werden. Ihr diskursiver Wert wird deshalb nicht geschmälert.
.
Empowerment und Resilienz
Wir können gesellschaftliche Phänomene mit zwei für die aktive Bewältigung der Klimakrise zentralen Konzepten ordnen. Das eine heißt Empowerment und meint die Selbstermächtigung von Menschen, ihre Interessen selbstbestimmt, auf eigene Initiative und Verantwortung hin zu folgen. Das zweite Konzept der Resilienz zielt darauf, zu verstehen, wie Menschen Probleme meistern und Widerstände überwinden können. Der Not geschuldete »Resilienzgemeinschaften« zeichnen sich durch ein hohes Maß an Teilhabe und Selbstorganisation aus. Bürgerbeteiligung ist eine wichtige Voraussetzung für die Effizienz staatlich organisierter Katastrophenvorsorge.
Selbstermächtigung und Widerstandsfähigkeit scheinen für eine Gesellschaft, die eventuell mit extremen und katastrophalen Veränderungen das Klimas und raschen sozialem Wandel zurechtkommen muss, entscheidende Fähigkeiten »jenseits von Staat, Markt und Technik« zu sein. Deshalb definiert die Katastrophenforschung solche sozialen Systeme als resilient, die ihre zentralen Funktionen auch dann aufrechterhalten können, wenn sie unter extremen Wandlungsdruck von außen geraten. Im Nord-Süd-Verhältnis bedeutet das: Man kann von Gesellschaften lernen, die angesichts regelmäßig auftretender Umweltkatastrophen wie Erdbeben oder Wirbelstürmen haltbare Bau- und Siedlungsformen und eine mentale Gelassenheit entwickelt haben. Man kann im Süden studieren, wie sie auf demokratieverträgliche Weise mit Umweltveränderungen zurechtkommen (vgl. LEGGEWIE/WELZER 2011).
.
Nichtnachhaltigkeit – Das Ende des Erdölzeitalters
Die Welt steht vor einer Vielzahl von globalen Herausforderungen, die teilweise im Prinzip erkannt und auch von der Gesellschaft im Prinzip als solche eingeschätzt werden (Klima, Naturzerstörung, Artenvielfalt usw.). Das in seiner Aktualität und Tragweite noch nicht wirklich wahrgenommene Zu-Ende-Gehen des fossilen Zeitalters. Öl ist die Basis der Lebensweise im industrialisierten Teil der Welt.
Billige und reichlich vorhandene Energie ist die Grundlage des Wirtschaftens in der industrialisierten Welt, sie bestimmt die Produktionsbedingungen, das Konsumverhalten und die Mobilität. Billige und reichlich vorhandene Energie ist damit Basis des heutigen »Business as usual«. Doch Energie wird in Zukunft weder reichlich vorhanden sein noch billig sein. Der erste fossile Energieträger, der knapp wird, ist Erdöl, der Treibstoff des fossilen Verkehrs zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Damit wird zuerst und auch zugleich massiv der Verkehr betroffen sein. Ein vollständiger Ersatz des abnehmenden Kraftstoffangebots durch Biokraftstoffe oder Wasserstoff und Strom wird in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht möglich sein.
Die von Peak Oil ausgelösten Umbrüche liegen nicht in einer unbestimmt fernen Zukunft, sondern zeigen sich bereits jetzt. Mit dem Erreichen des globalen Ölförderplateaus im Jahre 2005 hat General Motors, der damals weltweit größte Automobilhersteller, erstmals in seiner Geschichte rote Zahlen geschrieben. Wenige Jahre später gerieten fast alle Automobilfirmen außerhalb Chinas ebenfalls in eine Krise […]
Was wir gerade erleben, sind die Folgen des Erfolgs. Weil das westliche Entwicklungsmodell so attraktiv war, wurde es von immer mehr Ländern auf der Welt nachgeahmt, zuletzt von so bevölkerungsreichen Ländern wie China, Brasilien und Indien. Gerade deswegen kommt es umso schneller an sein Ende. Die Grenzen beim Öl werden jetzt erreicht und zeigen so die Nichtnachhaltigkeit der Nutzung fossiler Energieträger. Damit werden auch die lange vorhergesagten und immer wieder geleugneten Grenzen des Wachstums jetzt spürbar, auch wenn nach wie vor eine Ausweitung dieser Grenzen beschworen wird. Es geht nicht so weiter, weil es nicht so weiter gehen kann […]
Die Suche nach den Lösungen sollte nicht von einem zwangsläufig verschwommenen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ausgehen, sondern von der Nichtnachhaltigkeit bestehender Strukturen und Systeme. Dieser Ansatz ist deswegen angemessen, weil wir nicht wirklich wissen können, was nachhaltig ist. Aber wir können sehr genau wissen, was nichtnachhaltig ist. Der Begriff der Nichtnachhaltigkeit ist nur scheinbar trivial, vielmehr ist er extrem weitreichend: Etwas ist dann nichtnachhaltig, wenn es auch mit noch so viel Anstrengung (oder auch Gewalt) auf Dauer nicht fortzusetzen ist. Alles, was nichtnachhaltig ist, kommt an ein Ende. Wäre es anders, dann wäre es nicht nichtnachhaltig.
Es geht somit darum, sich von nichtnachhaltigen Entwicklungen rechtzeitig zu verabschieden, um eine harte Landung zu vermeiden. Die Einsicht in die Notwendigkeit sich von nichtnachhaltigen Strukturen zu lösen, erleichtert die Bereitschaft zur Suche nach neuen Wegen. Das gibt bereits eine Richtung vor, hin zu mehr Nachhaltigkeit, Leitplanken, sozusagen, für den einzuschlagenden Weg.
Die grundlegende Forderung ist wohl die nach der Verallgemeinerbarkeit der Lebensverhältnisse: Damit ist gemeint, dass nur solche Strukturen zukunftsfähig sind, die von allen Menschen auf der Welt heute und in Zukunft gleichermaßen gelebt werden können. Das gilt vor allem für den Energieverbrauch, den Flächenverbrauch, den Verbrauch von Rohstoffen und Materialien und die Arbeitsverhältnisse (vgl. BERGMANN 2008, SCHOR 2016). Das Prinzip der Verallgemeinerbarkeit ist eine wesentliche Bedingung für Nachhaltigkeit. Diese Forderung ist bei der heutigen Nutzung fossiler Energien offensichtlich nicht erfüllt […]
Noch eine Bemerkung zu der oft missverstandenen Beziehung zwischen Peak Oil und der Klimapolitik, denn beide Themen bilden keinen Gegensatz, sondern ergänzen sich. Es gilt die Klimadividende von Peak Oil zu nutzen: Da die Abkehr vom Öl unvermeidlich ist, ist eine aktive Klimapolitik in ihren Maßnahmen gleichgerichtet. In der gängigen Wahrnehmung wird proaktive Klimapolitik als etwas Freiwilliges empfunden – man kann das machen oder auch nicht. Dagegen ist die Abkehr vom Öl erzwungen. Es gibt keine Ausflüchte mehr, sich den Problemen zu stellen. Den Übergang (engl.: transition) hin zu einer postfossilen Welt positiv und proaktiv zu gestalten ist die große gesellschaftliche Zukunftsaufgabe. Sie steht jetzt an (vgl. SCHINDLER 2011).
Die Phänomene Peak Oil und der menschengemachte Klimawandel sind beide Ausdruck ein und derselben hoffnungslosen Abhängigkeit unserer industrialisierten Gesellschaften von fossilen Brennstoffen und unseres dadurch ermöglichten Lebensstils. Die zunehmende Knappheit der klassischen Flüssigbrennstoffe könnte zur verstärkten Nutzung anderer Ressourcen führen, die weit schlimmere Wirkung auf die Klimaentwicklung haben: Kohleverflüssigung, Ölsandausbeutung, Biodiesel usw. Wenn es uns nicht gelingt die sogenannte Versorgungslücke durch Energieeinsparung und umfassende Anstrengungen im Bereich der Relokalisierung zu schließen, dann werden wir die Klimaveränderungen in einer Weise beschleunigen, die uns das Leben zur Hölle machen wird (vgl. HOPKINS 2010).
„Jeder Zusammenbruch bringt intellektuelle und moralische Unordnung mit sich. Man muss sich nüchterne und geduldige Leute schaffen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens.“
(GRAMSCI 1991, Seite 136)
.
Ergänzende Hinweise:
Akademie Solidarische Ökonomie; Bender, Harald; Bernholdt, Norbert; Winkelmann, Bernd: Kapitalismus und dann? Systemwandel und Perspektiven gesellschaftlicher Transformation. 2012.
Allenby, Brad; Fink, Jonathan: Toward Inherently Secure an Resilient Societies. In: Science, Volume 309 (2005), Seite 1034-1036, hier.
Andreae, Steffen: Richtung ändern! Die wesentlichen Jahre – Aus den Anfängen der Transformation. 2016.
Antonovsky, Aaron: Health, Stress, and Coping. New Perspectives on Mental and Physical Well-Being. 1979.
Bankoff, Greg: Dangers to Going it Alone. Social Capital and the Origins of Community Resilience in the Philipines. In: Continuity and Change. Jahrgang 22 (2007), Heft 2, Seite 327-355.
Bankoff, Greg: Mapping Vulnerability. Disasters, Development and People. 2004.
Barth, Volker; Richter, Susanne: Der Kampf ums Öl. Geht unser Erdölzeitalter zu Ende. Ein Film von Volker Barth und Susanne Richter. arte, 55 Minuten. 2011, hier.
Bennholdt-Thomsen, Veronika: Geld oder Leben. Was uns wirklich reich macht. 2010.
Bergmann, Frithjof: Das Jobsystem nicht weiter päppeln, stattdessen die Arbeit anders denken. Ein Interviewausschnitt zu NeueArbeit-NeueKultur 2008, hier.
Bergmann, Frithjof; Friedland, Stella: Neue Arbeit kompakt – Visionen einer (selbst)bestimmten Gesellschaft. 2007.
Bergmann, Frithjof: Neue Arbeit – Skizze mit Vorschlag. In: Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.): Neue Arbeit – neue Gewerkschaften. Gewerkschaftliche Monatshefte. Jahrgang 1997, Ausgabe 9-10, Seite 524-534, hier.
Berndt, C.: Resilienz – Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft. 2013.
Burka, Uwe: Eine zukunftsfähige Geld- und Wirtschaftsordnung für Mensch und Natur. Jeder kann mitgestalten… 2. Auflage 2017, hier und hier.
Campbell, Colin; Liesenborghs, Frauke; Schindler, Jörg; Zittel, Werner: Ölwechsel! Das Ende des Erdölzeitalters und die Weichenstellung für die Zukunft. 2002.
Campbell, Colin; Laherrere, Jean: The Worlds Oil Supply 1930-2050. Petroconsultants Genf. 1995.
Dahm, Daniel; Scherhorn, Gerhard: Urban Subsistenz. Die 2. Quelle des Wohlstands. 2008.
Diefenbacher, Hans: Die Zukunft der Volkswirtschaften: Nachhaltiges Wirtschaften. Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der Hans-Böckler-Stiftung. Tagung: IMKForum 2016. 17.3.2016, hier. (vgl. auch: hier, hier, hier, hier, hier).
Diefenbacher, Hans: Die Bedeutung einer Veränderung der Rolle von Wachstum und Arbeit in einer Postwachstumsgesellschaft. In: Welzer, Harald; Wiegandt, Klaus: Wege aus der Wachstumsgesellschaft. 2013, Seite 158-180, hier.
Exner, Andreas: Von der Nachhaltigkeit zur Resilienz? Mögliche Diskursveränderung in der Vielfachkrise. In: Phase 2, 2013, Nr. 45, hier und hier.
Howaldt, Jürgen; Kopf, Hartmut (Hrsg.): Erklärung Soziale Innovationen für Deutschland. Version 2.0, 11.09.2014, hier.
Felgentreff, Carsten; Glade, Thomas (Hrsg): Naturrisiken und Sozialkatastrophen. 2007.
Fleck, Ludwik: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. 1980.
Flieger, Burghard: Prosumentenkooperation. Geschichte, Struktur und Entwicklungschancen gemeinschaftsorientierten Wirtschsaftens in der Ernährungswirtschaft am Beispiel der Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften. 2016.
Frey, Wolfgang, Henkel-Waidhofer, Johanna: Free Energy. Energiewende – verblüffend einfach. 2012, hier.
Frey, Wolfgang: Freiburg Green City. Wege zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 2010, hier, hier und hier.
Freyberg, T. v.: Resilienz – Mehr als ein problematisches Modewort? In: Zander, M. (Hrsg.): Handbuch der Resilienzförderung. 2011, Seite 219-23.
Fuhrhop, Daniel: Verbietet das Bauen. Eine Streitschrift. 2015, hier.
Ganser, Daniele: Wie Europa vom Erdöl abhängt. Radiointerview in DRS 2, Sendung: Kontext. 30.11.2012, hier.
Ganser, Daniele: Europa im Erdölrausch. Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit. 2012.
Ganser, Daniele Dr., Schweizer Historiker, Energie- und Friedensforscher, erklärt anlässlich seines Vortrags beim VN-Klimaschutzpreis 2012, wie es um die energiepolitische Zukunft der Erde steht und die Perspektive einer 2000 Watt Gesellschaft. 22.11.2012, hier.
Ganser, Daniele; Kneissl, Karin; Richert, Jörg; Klare, Michael; Smith-Stegen, Karen: Energy Security and the Geopolitical Dimension of Fossil Fuel Availability. Podiumsdiskussion im Rahmen der ASPO-Jahreskonferenz 2012 in Wien, hier und hier.
Ganser, Daniele: Über den Peak Oil (Fördermaximum von Erdöl ist erreicht) und Energiekriege. Radiointerview in Deutschlandradio Kultur am 30.05.2012, hier.
Ganser, Daniele: Was passiert, wenn Erdöl knapp wird? Radiointerview in DRS 2, Sendung: Kontext. 22. 08. 2008, hier.
Goerner, Sally; Lietaer, Bernard; Ulanowicz, Robert: Quantifying economic sustainability. Implications for free-enterprise theory, policy and practice. In: Ecological economics. Jahrgang 69 (2009), Heft 1, Seite 76-81, hier.
Gramsci, Antonio: Gefängnishefte. Band 1. 1991, Heft 1, § 63.
Hahne, Ulf: Regionale Resilienz. Eine neue Anforderung an die ländliche Entwicklung und die künftige Regionalpolitik der EU. In: Kritischer Agrarbericht 2013, Seite 155-160, hier.
Hahne, Ulf: Resilienz – Neue Anforderungen an die Regionalentwicklung. In: Agrarsoziale Gesellschaft (Hrsg.): Ländlicher Raum. 64 (03), 2013, Seite 31-33.
Heinberg, Richard: Prioritäten setzen. In: Derselbe: Das Ende des Wachstums. Alte Konzepte – neue Realitäten. 2013, Seite 278-280, hier.
Heinberg, Richard: Graswurzelbewegte Orte des Übergangs. (Original in englisch: Transition Towns – The End of Growth. 2011.) In: Derselbe: Das Ende des Wachstums. Alte Konzepte – neue Realitäten. 2013, Seite 280-283, hier.
Heinberg, Richard: Clubs für gemeinsame Sicherheit (Original in englisch: Common Security Clubs – The End of Growth. 2011). In: Derselbe: Das Ende des Wachstums. Alte Konzepte – neue Realitäten. 2013, Seite 283-285, hier.
Heinberg, Richard: Wie könnte eine nachhaltige Gesellschaft aussehen? Ausblick. In: Derselbe: Das Ende des Wachstums. Alte Konzepte – neue Realitäten. 2013, ohne Seitenangabe, vgl. hier.
Heinberg Richard: Das Leben nach dem Wachstum. In: Heinberg, Richard: Das Ende des Wachstums. Alte Konzepte – neue Realitäten. 2013, Seite 277-278, vgl. hier (Original in englisch: The End of Growth. 2011),
Heinberg Richard: Bewältigung der Folgen des Wachstumsende. In: Heinberg, Richard: Das Ende des Wachstums. Alte Konzepte – neue Realitäten. 2013, Seite 283, vgl. hier.(Original in englisch: The End of Growth. 2011.)
Heinberg Richard: Die neue Wirtschaft bekannt machen. In: Heinberg, Richard: Das Ende des Wachstums. Alte Konzepte – neue Realitäten. 2013, Seite 285-289, vgl. hier (Original in englisch: The End of Growth. 2011).
Heller, J.: Resilienz – 7 Schlüssel für mehr innere Städte. 2013.
Holling, C. S. „Buzz“: Wisdom seminar with C. S. (Buzz) Holling, 21 November 2007 Stockholm Resilience Centre, hier.
Holling, C. S.: Resilience and stabability of ecological systems. In: Annual Review of Ecological Systems. Jahrgang 4 (1973), Seite 1-23.
Hopkins, Rob: Ausstieg aus der fossilen Energie und das Potenzial innovativer Wachstums- und Konsummodelle. Interview mit Rob Hopkins, einem Permakultur-Experten, dessen Netzwerk „Transition“ mittlerweile in 50 Ländern aktiv ist. Arte, Sendung Vox Pop am 03.02.2018, hier.
Hopkins, Rob: Brauchen wir Transition wirklich? In: Derselbe: Einfach. Jetzt. Machen! Wie wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. 2014, Seite 72-73, hier.
Hopkins, Rob: Resilienz denken. In: Helfrich, Silke, Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Commons. 2012, Seite 45-50, hier.
Hopkins, Rob; Meacher, Michael; Higgins, Polly: Confronting Change. Event organised by Jo Homan and Jamie Mayer (Transition Finsbury Park and Transition Highbury). South Bank Centre, December 16th 2010, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier und hier.
Hopkins, Rob: Energiewende – Das Handbuch. Anleitung für zukunftsfähige Lebensweisen. 2008.
Howaldt, Jürgen; Kopf, Hartmut (Hrsg.): Erklärung Soziale Innovationen für Deutschland. Version 2.0, 11.09.2014, hier.
Howaldt, Jürgen; Jacobsen, Heike (Hrsg.): Soziale Innovation. Auf dem Weg zu einem postindustriellen Innovationsparadigma. 2010.
Hopkins, Rob: Energiewende – Das Handbuch. Anleitung für zukunftsfähige Lebensweisen. 2. Auflage, 2010.
Hopkins, Rob: The Transition Handbook. From Oil dependency to local resilience. 2008.
Hüther, Gerald: Kommunale Intelligenz. Potenzialentfaltung in Städten und Gemeinden. 2013.
Jakubowski, P.; Kaltenbrunner, R.: Resilienz – oder: Die Zukunft wird ungemütlich. In: Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung (BBSR) (Hrsg.): Resilienz, Informationen zu Raumentwicklung. 2013, Nr. 4, Seite 279-286.
Jakubowski, P.; Lackmann, G.; Zahrt, M.: Zur Resilienz regionaler Arbeitsmärkte – theoretische Überlegungen und empirische Befunde. In: Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung (BBSR) (Hrsg.): Resilienz, Informationen zu Raumentwicklung. 2013, Nr. 4, Seite 351-370.
Jakubowski, P.: Resilienz – eine zusätzliche Denkfigur für gute Stadtentwicklung. In: Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung (BBSR) (Hrsg.): Resilienz, Informationen zu Raumentwicklung. 2013, Nr. 4, Seite 371-378.
Kaltenbrunner, R.: Mobilisierung gesellschaftlicher Bewegungsenergien – Von der Nachhaltigkeit zur Resilienz – und retour? In: Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung (Hrsg.): Resilienz, Informationen zu Raumentwicklung. 2013, Nr. 4, Seite 287-295.
Kegler, Harald: Resilienz. Strategien & Perspektiven für die widerstandsfähige und lernende Stadt. 2014.
Kennedy, Margrit; Lietaer, Bernard: Regionalwährungen. Neue Wege zu nachhaltigem Wohlstand. 2004.
Kennedy, Margrit: Interest and Inflation Free Money. How to create an Exchange Medium that works for everybody. Permaculture Institute e.V., Steyerberg, Federal republic of Germany. 1988.
Kennedy, M. (Hrsg:): Öko-Stadt. 1983 (vgl. hier, hier, hier, hier und hier).
Konzeptwerk Neue Ökonomie (Hrsg.): Zeitwohlstand. Wie wir anders arbeiten, nachhaltig wirtschaften und besser leben. 2014, hier.
Korovicz, David: Umkipp-Punkt: Kurzfristige systemische Folgen des Rückgangs der globalen Ölproduktion. Erschienen bei Feasta & The Risk/Resilience Network, aus dem Englischen von Gerhard Wiesler, 15. März 2010 2010, hier.
Kriener, Manfred: Peak Oil ist jetzt. Kommentar, in: die tageszeitung, 06. Februar 2012, hier.
Kuhn, Thomas: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Original englisch 1965. 1985.
Leggewie, Claus; Welzer, Harald: Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft und die Chancen der Demokratie. 2011.
Lenz, Albert; Stark, Wolfgang (Hrsg.): Empowerment. Neue Perspektiven für psychosoziale Praxis und Organisation. 2002.
Lietaer, Bernard; Arnsperger, Christian; Goerner, Sally; Brunnhuber, Stefan: Geld und Nachhaltigkeit. Von einem überholten Finanzsystem zu einem monetären Ökosystem. Ein Bericht des Club of Rome / EU-Chapter. 2013.
Lietaer, Bernard: Das Geld der Zukunft. Über die zerstörerische Wirkung unseres Geldsystems und Alternativen hierzu. 2. Auflage 2002.
Lietaer, Bernard: Mysterium Geld. Emotionale Bedeutung und Wirkungsweise eines Tabus. 2000.
Maak, Niklas: Wohnkomplex. Warum wir andere Häuser brauchen. 2014.
Meadows, D.; Nakicenovic, N.; Aleklett, K.; Gilbert, J.: 10 Years of ASPO – Lessons Learned. Podiumsdiskussion im Rahmen der ASPO-Jahreskonferenz 2012 in Wien, hier.
Meadows, Dennis: Preparing cities for the age of declining oil. 23.11.2011, hier.
Meadows, Dennis: In der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ im Bundestag (vgl. hier) sprach Dennis Meadows auch über Krisenfestigkeit am 24.10.2011, hier.
Meadows, Dennis: In der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ im Bundestag (vgl. hier) sprach Dennis Meadows auch über Peak Oil und die Vorlage, die die Energy Watch Group dazu gemacht hat am 24.10.2011, hier.
Meadows, Dennis: Vor der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ (vgl. hier) äußerte sich der US-Ökonom am Montag, 24. Oktober 2011 pessimistisch, was die Chancen zur Umsetzung entsprechender Reformen angeht. Der fortschreitende Klimawandel, die Verknappung der Ressourcen oder der wachsende Gegensatz zwischen Arm und Reich lehrten, dass es für eine „nachhaltige Entwicklung eigentlich schon zu spät ist“. Der emeritierte Professor warf Politik wie Bürgern vor, vorwiegend an kurzfristigen Vorteilen statt an langfristigen Erfordernissen interessiert zu sein, hier.
Meadows, Donella: Die Grenzen des Denkens. 2010.
Meadows, Donella; Randers, Jørgen; Meadows, Dennis: Grenzen des Wachstums, das 30-Jahre-Update. Signal zum Kurswechsel. 2006.
Meadows, Donella; Meadows, Dennis; Randers, Jørgen; Behrens III, William: Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. 1972.
Mertens, Klaus: Postfossile Zeiten und industrielle Zukunft. In: Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.): Gegenblende. Jahrgang 2013, Ausgabe 21, hier.
O’Connor, Dermot: Es gibt kein Morgen. Ein Film von Dermot O’Connor. 35 Minuten. 2012, hier und hier.
Newman, Peter; Beatley, Timothy; Boyer, Heather: Resilient Cities. Responding to Peak Oil and Climate Change. 2009.
Oekom – Verein für ökologische Kommunikation (Hrsg.): Baustelle Zukunft. Die große Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Reihe: Politische Ökologie, Jahrgang 31 (2013), Band 133.
Oekom – Verein für ökologische Kommunikation (Hrsg.): Post Oil City. Die Stadt von morgen. Reihe: Politische Ökologie, Jahrgang 29 (2011), Band 124.
Ostrom, Elinor: Elinor Ostrom on resilient social-ecological systems. Seminar, 2007, hier.
Pestel-Institut: Regionale Krisenfestigkeit. Eine indikatoren -gestützte Bestandsaufnahme auf Ebene der Kreise und Kreis-freien Städte. Diskussionspapier. 2010, hier.
Pfluger, Christoph: Geld verstehen! Kurze Anleitung zur Überwindung des kollektiven Irrtums, 2017, hier und hier.
Rost, Norbert: Europa nach dem Peak Oil. 2012, hier.
Schindler, Jörg; Zittel, Werner: Doch (k)ein Ende in Sicht? Peak Oil, Fracking und die Zukunft der Mobilität. Vortrag von Jörg Schindler und Dr. Werner Zittel (beide ASPO Deutschland und Ludwig-Bölkow-Stiftung) am 19. Oktober 2018, hier.
Schindler, Jörg: Zeitenwende: Der Anfang vom Ende des fossilen Zeitalters und die daraus folgenden „Großen Transformation unserer Welt“ am 27. Februar 2014, in 4 Teilen hier, hier, hier und hier.
Schindler, Jörg: Die Wahrnehmung von Peak Oil in der Öffentlichkeit. In: Derselbe:Öldämmerung. Deepwater Horizon und das Ende des Ölzeitalters. 2011, Seite 89-108. hier. (Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO) Deutschland e.V., hier.)
Schindler, Jörg: Die Utopie einer postfossilen Welt. Vortrag bei Tage der Utopie / St. Arbogast in Vorarlberg. 2005, hier.
Schindler, Jörg; Zittel, Werner: Schriftliche Stellungsnahme zu ausgewählten Fragen der Kommission zum Thema: Weltweite Entwicklung der Energienachfrage und der Ressoucenverfügbarkeit. Öffentliche Anhörung von Sachverständigen durch die Enquête Kommission des Deutschen Bundestages „Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und der Liberalisierung“. Ludwig-Bölkow-Systemtechnik. 2000, hier.
Schindler, Jörg; Zittel, Werner: Fossile Energiereserven (nur Erdöl und Erdgas) und mögliche Versorgungsengpässe aus Europäischer Perspektive. Endbericht und Studie im Auftrag des Deutschen Bundestages, Ausschuss für Bildung, Technik und Technikfolgenabschätzung. 2000, hier.
Schnur, O.: Resiliente Quartierstentwicklung? Eine Annäherung über das Panarchie-Modell adaptiver Zyklen. In: Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung (BBSR) (Hrsg.): Resilienz, Informationen zu Raumentwicklung. 2013, Nr. 4, Seite 337-350.
Schor, Juliet: Wahrer Wohlstand. Mit weniger Arbeit besser leben. 2016, hier.
Sieverts, Thomas: Am Beginn einer Stadtentwicklungsepoche der Resilienz? Folgen für Architektur, Städtebau und Politik. In: Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung (BBSR) (Hrsg.): Resilienz, Informationen zu Raumentwicklung. 2013, Nr. 4, Seite 13-23.
Stratmann, Bernhard: Urbane Transformationstrends – Das Zauberwort heißt Resilienz. In: Verein für politische Ökologie e.V. (Hrsg.): Baustelle Zukunft – Die Große Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Reihe: Politische Ökologie, Band 133. 2013, Seite 102-107, hier und hier.
Transition Town Freiburg e.V.: Arbeitspapier Resiliente Stadtgesellschaft. Redaktion Jörg Beger. 18.03.2019, hier.
Ulanowicz, Robert; Goerner, Sally; Lietaer, Bernard; Gomez, Rocio: Quantifying sustainability: Resilience, efficiency and the return of information theory. In: ecological Complexity. Jahrgang 6 (2009), Heft 1, Seite 27-36, hier und hier.
Vale, Lawrence; Campanella, Thomas (Hrsg.): The Resilient City. How Modern Cities Recover from Disaster. 2005.
Wagner, Hartmut: Resiliente Teams in Transition Town. Unveröffentlichte Vortragsfolien zum Workshopdesign. 2015, hier.
Wagner, Hartmut: Wie entwickeln wir resiliente Teams in Transition Town? Unveröffentlichtes Exposé zum interaktiven Workshop. 2014, hier.
Wagner, Hartmut; Tscheuschner, Marc: TMS – Teammanagement System. Reike: 30-Minuten. Offenbach: Gabal. 2009.
Wagner, Hartmut; Tscheuschner, Marc: TMS – Der Weg zum Hochleistungsteam. Praxisleitfaden zum Team Management System nach Charles Mergerison und Dick McCann. Offenbach: Gabal. 2008.
Walker, Brian; Salt, D.: Resilient Practice. Building Capacity to Absorb Disturbance and Maintain Function. 2012.
Wessely, Dominik: Gottes Plan und Menschen Hand – Die Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung oder wie unsere Städte in die Welt kamen. Ein Film von Dominik Wessely. SWR / ARTE, 52 Minuten. 2004, hier.
Zander, M. (Hrsg.): Handbuch der Resilienzförderung. 2011.
Ziegler, Jean: Wie kommt der Hunger in die Welt? Ein Gespräch mit meinem Sohn. 3. Auflage, 2002.




